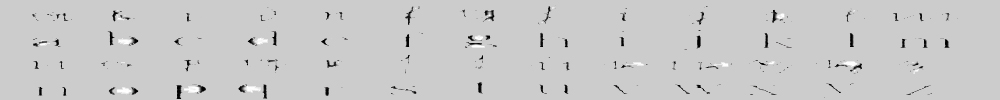| literaturgeschichten | chronos | kommentar | publikationen | index | downloads | impressum |
| blättern [zurück] [weiter] |
Leben und Denken im Wort
§ 7 | Vor dem Spiegel
Der Vater, William Stern, war kein abwesender Vater wie in vielen anderen bürgerlichen Familien. Er war anwesend, aufmerksam, fordernd und förderte den Sohn nach Kräften: „Zu meinem Geburtstag hat er mir den Kopf des Vaters, nach der neuesten Photographie kopiert, geschenkt. Er verfertigte ihn unter Anleitung des Vaters, der ihn auf viele Fehler aufmerksam machte und auch angab, wie sie zu verbessern seien; selbst Hand angelegt hat der Vater nicht – doch ‚Geist‘ angelegt. Und so entstand das im Couvert liegende, immerhin erkennbare Bild.“ (Tagebuch VII / Günther / 15.3.1911)
Der Vater beobachtete den Sohn genau, widmete ihm und seinen Geschwistern viel Zeit und ließ die Ergebnisse in seine Bücher einfließen. Der Sohn fühlte sich in seiner Beziehung zum Vater wohl und gut aufgehoben. Es gab wenig Fremdheit zwischen den beiden. Dennoch war es sicher nicht leicht für ihn, Sohn des berühmten William Stern zu sein, wie folgende Notiz der Mutter zeigt: „Professorensöhne leiden unter dem Nimbus ihres Vaters – wenigstens in der Schule. Die Kameraden und die Lehrer glauben, von einem professoral Geborenen das Höchste erwarten zu können. Wehe dem armen Gelehrtenableger, wenn er mal nur ‚schwache Triebe‘ zeitigt!“ (Tagebuch VII / Günther / 23.6.1911)
Die Förderung durch den Vater, die Anerkennung seiner besonderen Talente, von denen die Mutter in ihren Tagebüchern immer wieder berichtete, führte dazu, daß Günther Anders sich als etwas Besonderes empfinden mußte. Die Besonderheit lag aber auch in der Position, die der Vater in der Familie und in der Gesellschaft einnahm: „Günther leidet unverkennbar an dem Streben, ‚anders’ sein zu wollen als die Kameraden. Er möchte originell sein. Vor dem Untertauchen in der Masse hat er geradezu Angst. Sogar, wenn er an Beruf und Zukunft denkt, macht er sich Sorgen darüber, ob er auch etwas ‚Besonderes’ werden wird. Er fürchtet, in nichts etwas Tüchtiges erreichen zu können – tüchtig im Sinne von das Mittelmaß überragend. Er verweist immer auf den Vater, – der so hoch über dem Durchschnittsmenschen stände und – an diesem Punkte erwacht sein Ehrgeiz.“ (Tagebuch VIII / Günther / 23.1.1917)
Der Vater blieb ihm Vorbild bis ins hohe Alter, insbsondere in Bezug auf seine Disziplin beim Arbeiten, seinen sozialen Status in der Welt und das Verhältnis zu Frauen. Im Bereich des Denkens zeigten sich allerdings Gegensätze, die sehr bald immer deutlicher zu Tage traten. Schon bevor Günther Anders Hamburg verließ, am Ende seiner Jugendzeit, zeigte sich eine Entfremdung vom Vater. Diese Loslösung war schmerzlich und befreiend zugleich, denn „so hat Vater – was vielleicht ganz gut ist – niemals erfahren, was dort oben, dort oben im zweiten Stock, geschehen ist, ich meine mit mir geschehen ist, als er mir (gewiß, um mich mit den Kulturschätzen seines geliebten Deutschland vertraut zu machen) den Erlkönig vorsang: daß er damals nämlich, da er selbst nach einem Vater schrie, mein Vertrauen in ihn als Gottvater zerstört hat, und daß er von Stund an für mich nur noch ein Mensch gewesen ist“. (Anders 1979:128) Besonders schmerzlich für ihn muß gewesen sein, daß mit dem Urvertrauen in den Vater auch die letzte Bastion der Sicherheit fiel. Der Respekt, den der Sohn dem Vater entgegenbrachte, konnte dadurch aber nicht erschüttert werden. Er schrieb mehr über diesen als über die Mutter und behielt ihn bis ins hohe Alter immer in seiner Nähe: „Bei unserer Ankunft in diesem kärglich ausgestatteten Raum hatten wir gleich die mit einer Heftzwecke an der Tür befestigte Photographie des Vaters entdeckt. [...] Es war also nicht nur unseretwegen da gewesen, sondern es war immer da als Ausdruck der Bindung an den Vater, die trotz aller Unterschiede zwischen ihnen überdauernd und tief verankert in Liebe und Achtung beruht.“ (Schmidt 1991:121)
Die enge emotionale Verbundenheit konnte aber die Kritik am Verhältnis seines Vaters zur Welt nicht verhindern. Bereits nach der Loslösung vom Elternhaus schien sich eine tiefgreifende intellektuelle Entfremdung abzuzeichnen. Auch die neuen Kontakte in Freiburg zu Edmund Husserl und später in Marbach zu Martin Heidegger und zu seiner ersten Frau Hannah Arendt trugen dazu bei, daß sich Günther Anders aus der Geisteshaltung des Vaters und der Mutter, die geprägt war vom Glauben an Humanität und Aufklärung, befreien konnte. Aber viel später erst, als der Vater bereits im Exil verstorben war, sollte der intellektuelle Bruch auch emotional vom Sohn verarbeitet werden.
Im Breslau der zehner Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts war noch alles in Ordnung, in jener Stadt, „in der wir von Sieg zu Sieg eilten, in eine Zukunft hinein, in der es natürlich weder ein Verdun gab, noch eine russische Revolution, noch eine Inflation, noch einen Hitler, noch ein Auschwitz, noch ein Hiroshima, noch ein Vietnam, sondern nur ein einziges gigantisches, schuldfreies, fahnenflatterndes, die Welt zum Genesen bringendes Deutschland.“ (Anders 1967a:295) In diesem Deutschland nahm alles seinen Lauf. In diesem Deutschland, in dem der Vater als deutscher assimilierter Jude lebte und arbeitete, immer mit der Hoffnung, „daß es ihnen (...) gelingen würde, von allen Deutschen als eingeborene Deutsche anerkannt und willkommen geheißen zu werden, entweder durch das Studium des Mittelhochdeutschen oder durch das Spielen von Beethovensonaten oder durch die Abfassung von Büchern über Lessing, Kant oder Goethe“. (Anders 1967a:280) Diese Anpassungsleistung nützte der Familie Stern aber nichts. Das zeigte sich bereits in den späten zwanziger Jahren.
Die vielleicht wesentlichste Kritik, die Günther Anders an seinem Vater übte, war, diesen Prozeß der beginnenden Vernichtung von Menschen nicht sehen zu wollen oder zu können. Sohn und Vater lebten in unterschiedlichen Zeiten, beinahe könnte man sagen in unterschiedlichen Epochen. In seinem Tagebuch Besuch im Hades setzte sich Günther Anders intensiv mit seinem Vaterbild auseinander, mit seinen Erinnerungen an die Heimat. Er reiste 1966 nach Breslau, streunte orientierungslos durch die Gassen und versuchte jene Zeit wiederzufinden, die vor Hiroshima lag. Erst der Bahnhof, ein wiedererstandenes Relikt aus dem neunzehnten Jahrhundert, gab ihm Halt und Orientierung: „Es ist der Bahnhof, der erste Bahnhof, den ich je gekannt hatte, der schon damals uralte und lächerliche ‚Hauptbahnhof’ mit Türmchen und Zinnen, ‚die große Ritterburg’, wie wir sie genannt hatten. [...] Es ist nicht zu glauben: gerade das mußte, als alles in Schutt sank, gerade das mußte also stehenbleiben, gerade das intakt den Untergang überleben.“ (Anders 1967a:303)
Trotz dieser Leuchttürme, die in Gestalt von Wasserspeichern und Kirchtürmen überall zwischen den zerstörten Häusern aufragten, nahm es mehrere Tage in Anspruch, bis sich Günther Anders zurechtfand, weil die Stadt immer noch zerstört war; ganz im Gegensatz zu deutschen Städten, denn „so hatte Köln selbst im Jahre 50 nicht mehr ausgesehen, welch ein Unterschied zwischen den Städten, die zerbombt, und denen, die systematisch von der Artillerie niedergelegt worden sind. Wie Stalingrad muß Breslau ausgesehen haben“. (Anders 1967a:298)
Bis er die alten Markierungspunkte wiederfand, bis er sich hineinwagte ins Zentrum seiner Urgeschichte, dorthin, wo der Vater unumstritten lebte, wo die Welt intakt war, wo es so etwas wie Heimat gegeben haben mußte, dauerte es ein paar Tage, weil seine Orientierungslosigkeit ja eher einer psychologisch-geographischen Problematik entsprang. Seines Wissens nach erreichte er die Stadt von der falschen geographischen Seite her. Er fuhr von Südosten aus auf seine damalige Schule zu, was die ganze Psychologie der Ereignisse auf den Kopf stellte. Er reiste also von der falschen Seite an. Fast ein Programm für sein Leben, denn er kam aus einer Richtung, aus der er, als Breslau noch intakt gewesen war, sein Leben noch am Anfang stand, sich niemals seiner unmittelbaren Heimat genähert hatte, aus der er niemals „angefahren war, niemals aus Südost, niemals aus Auschwitz, sondern immer aus Südwest, aus der Sicherheit, von Zuhause mit der Nummer Vier von der Gabitzstraße bis zur Brüderstraße, und welche Haltestellen es vor der Gabitzstraße und hinter der Brüderstraße noch gab, und wie die Welt jenseits der Haltestellen aussah, und daß jenseits auch noch Ohlau lag und Oppeln und Kattowitz und Auschwitz, mindestens liegen würden, das hatte ich mir damals natürlich niemals klargemacht“. (Anders 1967a:299)
Zwischen 1945 (Hiroshima) und 1966 (Zeitpunkt der Reise) hatte Günther Anders die Markierungspunkte seiner Lebensgeschichte jenseits des Lebens mit der Familie und dem Vater neu gesetzt. Er bereiste die Welt nun immer aus Richtung Auschwitz, Hiroshima und Vietnam. So kam er überall von der falschen Seite an. Er konnte die Welt nicht mehr von der Seite der Vorkriegszeit, von der Seite des Vaters aus bereisen. Als Vertriebener hatte er sich eingenistet in den Vernichtungslagern von Auschwitz und Birkenau, in den atomverseuchten Städten von Hiroshima und Nagasaki und in den entlaubten Wäldern von Vietnam. Wie sein Vater vor ihm, beobachtete er eine (neue) Welt, die heraufdämmerte, zeichnete ihre ersten Schritte auf und überlieferte sie uns in seinen Tagebüchern, Essays und Büchern. Günther Anders imitierte das Verhalten seiner Eltern, er kartographierte seine Welt, so wie die Eltern einst zwischen 1902 und 1914 seine ganz persönliche und kindliche Entwicklung dokumentiert, ihn zum Objekt ihrer Forschung gemacht und sein Heranwachsen akribisch in ihren Tagebüchern aufgezeichnet hatten. Günther Anders suchte dagegen den kollektiven Weg, er dokumentierte die Entstehung einer Welt, die die Auslöschung der Menschheit technologisch vorbereitete. Er emanzipierte sich aus der Imitation und überschritt seine Eltern in einem entscheidenden Punkt: Er nahm nicht das Individuum als Angelpunkt seiner Betrachtungen, also nicht das werdende Kind, sondern das Kollektiv, die Menschheit. Er konnte gar nicht anders, denn sein Nullpunkt war Hiroshima, und dieser besagte, daß die Menschheit in die Lage versetzt wurde, sich und letztlich alle höheren Lebensformen auszulöschen. Hieß es bei seinem Vater noch Person und Sache, so lautete der Titel bei Günther Anders Mensch ohne Welt und in späterer Folge Welt ohne Mensch. Seine akribische Kartographie läßt den Vater ebenso antiquiert erscheinen, wie es Günther Anders letztlich selbst gewesen ist – mit dem Unterschied, daß er einen Begriff dieser Antiquiertheit hatte, er sich des drohenden Untergangs bewußt war, während sein Vater bis zuletzt nicht glauben wollte (und vermutlich auch nicht konnte), daß dieses Europa in Schutt und Asche versinken würde. William Stern war in seiner Zeit gefangen, er konnte sie nicht verlassen, konnte keine Zukunft antizipieren, in der es ihn nicht mehr geben würde. Er war ein aufgeklärter, assimilierter jüdischer Bildungsbürger des neunzehnten Jahrhunderts, des Jahrhunderts der positiven Vernunft, des aufgeklärten Humanismus und des unbeschränkten Glaubens an den wissenschaftlich-technischen Fortschritt. William Stern war und blieb bis zuletzt ein hochgeachteter Professor der Psychologie, ein Mann von Weltruhm und Ehrenhaftigkeit, integriert in das akademische Milieu, Familienvater und monogamer Ehemann. Allesamt Eigenschaften, die im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts radikal in Frage gestellt wurden, ja zum Teil gänzlich verlorengingen.
Günther Anders setzte sich mit seinem Vater wesentlich stärker auseinander als mit seiner Mutter. In seinem Gedicht Vor dem Spiegel aus dem Jahre 1942, also vier Jahre nach dem Tod des Vaters, gab er der Erinnerung an ihn einen literarischen Rahmen. Der Spiegel machte es ihm möglich, die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede zu betonen; alles darin ist seitenverkehrt, und Günther Anders‘ Leben kann so auch als Versuch gewertet werden, diese Seitenverkehrung umzusetzen. Er emanzipierte sich aus seinem Elternhaus, weil er fähig war, zu begreifen, daß er zum Spiegelbild seines Vaters geworden war. Der Vater lebte im Spiegel, der Sohn stand davor und war umgeben von einer Welt, die ihn und mit ihm die ganze Welt vernichten würde, wenn er nicht philosophisch und auch mit seiner Person gegen die Weltanschauungen seines Vaters Stellung bezog. Günther Anders war nie ins akademische Milieu integriert; in Wien, der Stadt, die er nach 1952 seine Heimat nannte, lebte er nahezu unerkannt, und als Ehemann war ihm die Monogamie höchstens als serielle Abfolge ein Begriff. Vater ist er ohnehin nicht geworden.
William Stern schrieb über die Konstituierung des Kindes zum Menschen, über den Spracherwerb und vieles mehr. Günther Anders jedoch schrieb über die Prozesse, die diese Entwicklung behinderten oder in Zukunft gar unmöglich machen würden: „Wahrhaftig, es gibt Zeiten, Tage und Augenblicke, in denen es unmöglich scheint, nicht hysterisch zu werden – einfach deshalb, weil uns zu viel Revoltierendes gleichzeitig zugemutet wird. Gute Zeiten müssen das gewesen sein – ich kann mich kaum mehr entsinnen –, als es noch erlaubt war, uns jeweils immer nur über eine, eine einzige, Infamie aufzuregen; als wir uns noch emotional konzentrieren durften.“ (Anders 1967a:273)
Vielleicht hätte Günther Anders auch gerne die Beschaulichkeit und Behaglichkeit des Vaters gelebt, dieses konzentrierte Leben auf nur ein Problem hin. Aber hatte er es nicht ohnehin getan, indem er all seine Energie auf diese eine Frage der Auslöschung der Menschheit durch die Medien-, Atom- und Produktegesellschaft konzentrierte? Über diesen Spiegel, in dem er seinen Vater sah, als er selbst im Exil in Amerika lebte, schrieb Günther Anders:
„Ja, Vater, das ist ausgeträumt.
Solch Leben hab ich nun versäumt.
Mein Vierzigstes begann.
Doch denke nicht, daß ich bereu.
Auch ich blieb meiner Sache treu:
Und die fängt morgen erst an.“ (Anders 1985d:283)
Die wesentlichen Unterschiede zwischen Vater und Sohn sind angesprochen: Der Glaube an Kultur und Fortschritt war ausgeträumt, und dennoch anerkannte er die Treue seines Vaters zu einer bestimmten Sache, auch wenn es nicht die seine war. Denn sein stures Beharren auf bestimmten philosophischen und politischen Themen und Thesen sowie seine Unnachgiebigkeit gegenüber den Menschen verdankte Günther Anders vor allem seinem Vater: diesem aufrechten, der Wahrheit verpflichteten jüdischen Bürger deutscher Sprache. Doch Günther Anders‘ Denken lag nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Das neunzehnte Jahrhundert war ausgeträumt und in den Todeslagern von Auschwitz zugrunde gegangen. Nach dem Tod des Vaters (1938) und der Mutter (1945) begann Günther Anders‘ Aufstieg zum Philosophen von Weltrang – sie hatten Platz gemacht für ihren Sohn. Jetzt konnte er mit seiner Sache beginnen, die nicht die seines Vaters war:
„Was du nicht wünschtest, kannt’st du nicht
des Elends Grund verstand’st du nicht.
Gern hörtest du nicht zu.
Einst gab ich scheu dir zu verstehn:
‚Du bist zu klug, um fortzusehn.’
Da batst du: ‚Gib doch Ruh.’
Die Welt, die dir Erfolg gebracht,
hast du nicht einmal ausgelacht.
Stets bliebst du ihr loyal.
Kein Omen hat dich aufgestört,
kein Fackelaufmarsch dich empört,
und keine Reichstagswahl.
Als schließlich das Gewitter brach,
zerschlug der erste Schlag dein Dach,
hätt’ beinah dich gefällt.
Hättest du doch damals dich ermannt
und ohne falsche Scheu bekannt:
ich diente der falschen Welt.
Du starbst entsetzlich weit entfernt.
Ob du das Hassen noch gelernt?
Du lagst sehr still im Sarg.“ (Anders 1985d:283)
Diesem Verhältnis seines Vaters zur Welt setzte er eine andere Maxime entgegen, um das eigene Überleben zu sichern, was der Vater auf Grund seiner Realitätsverweigerung verabsäumt hatte, scheint dem Sohn gelungen zu sein. Bis ins hohe Alter blieb der Konflikt ungelöst, dennoch hatte sich Günther Anders vom Vater emanzipiert und neues Land für sich gewonnen und konnte ihn so in guter Erinnerung behalten:
„Bis fünf Uhr frühe saß ich
an seinem Bett. Und alle Nase lang
rief er nach Wasser. Doch, gottlob, das Fieber
ist nun vorbei. Nun sitzt er schon und baut
sich Iglus aus den Kissen.“
Und P.S.:
‚Anbei in Kurzschrift einige Notizen,
die ich bei Nacht an seinem Bett entwarf.
Ich zweifle noch. Doch eines Tages könnten
sie brauchbar werden.’
(Ja, ‚Notizen’ schrieb er.
Drei Jahre später waren sie ein Buch,
und wohl sein bestes. – Und das Kind, das damals
bis fünf Uhr früh und alle Nase lang
nach Wasser rief, war ich.)
Doch diesen Zettel
verwahr ich gut als Liebesamulett.“
(Anders 1952a / Das Amulett / Totenpost / LIT)
| blättern [zurück] [weiter] |
autor: raimund bahr | eingestellt: 29.6.2019 | zuletzt aktualisiert: 19.7.2019
index: [a] |
[b] |
[c] |
[d] |
[e] |
[f] |
[g] |
[h] |
[i] |
[j] |
[k] |
[l] |
[m] |
[n] |
[o] |
[p] |
[q] |
[r] |
[s] |
[t] |
[u] |
[v] |
[w] |
[x] |
[y] |
[z]
literaturgeschichten | chronos | kommentar | publikationen | index | downloads | impressum